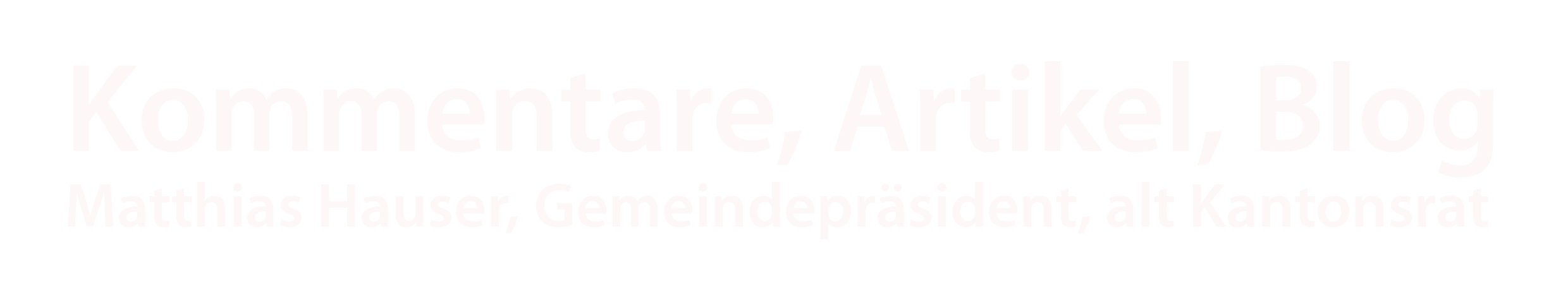Die Befürworter des Lastenausgleichs für die Stadt Zürich sagen, es stehe die gute Beziehung Stadt-Land auf dem Spiel, die Sache sei seit 1979 pendent und die SVP sei die einzige Partei, die dagegen sei. Offensichtlich haben diese Argumente mit dem Kern des Gesetzes nichts zu tun. Wenn man sich die Mühe macht, die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes nicht einfach als «überreifes Beziehungsbalsam» zu empfehlen, sondern schaut, um was es sich dabei genau handelt, dann wird gut verständlich, warum man zu diesem Lastenausgleich am 7. Februar «Nein» stimmen muss und die Kantonshauptstadt trotzdem gern haben kann. Die wichtigsten Gründe seien hier genannt:
Die ganzen Berechnungen für die Zahlungen des Kantons an die Stadt enthalten a.). einen «komischen Mechanismus» und stehen b.). auf einer untauglichen Grundlage. Es werden nämlich die «Pro-Kopf-Aufwände» zwischen Test-Landgemeinden und der Stadt verglichen. Beispielsweise im Bereich Kultur werden 300 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-Aufwandes der Landgemeinden vom Pro-Kopf-Aufwand der Stadt abgezählt. Die Differenz multipliziert mit der Anzahl Einwohner der Stadt soll dann eben die Zentrumslast sein und wird vom Kanton bezahlt. Die Vorlage schreibt vor, dass dieser Betrag alle drei Jahre vom Regierungsrat nach diesem Modell festgelegt wird. Wenn nun die Stadt nicht spart (der Pro-Kopf-Aufwand nimmt zu) und die Landgemeinden sparen (der Pro-Kopf-Aufwand nimmt ab) wird die Differenz höher und die Stadt erhält automatisch mehr Geld. Nicht sparen wird sich lohnen. Ein komischer Mechanismus, um die Finanzen unserer Gemeinschaft in Ordnung zu bringen.
Zudem stimmt es nicht, dass die Pro-Kopf-Aufwand-Differenz nur durch die Zentrumslast bedingt ist. In den Bereichen Kultur und Soziales leistet Zürich von sich und für sich mehr, als Landgemeinden dies tun (insbesondere auch in den Verwaltungskosten). Teilweise wurden im Lastenausgleich enthaltene «Kultursubventionen» explizit vom städtischen Stimmvolk gewünscht. Ob der Kanton in seiner Mehrheit da auch zugestimmt hätte, steht in den Sternen. Es ist höchst undemokratisch, wenn die einen in Zukunft für etwas zahlen müssen, das nur andere gewollt haben. Gerechter wäre es, diejenigen Lasten einzeln zu übernehmen, die auch der kantonale Bürger beanspruchen will. Am 7. Februar steht somit eine ungerechte Pauschallösung zur Abstimmung.
Neben der Tatsache, dass von Zentrumsvorteilen der Stadt und Randregionen-Nachteilen der Landschaft für die einzelnen Bürger (z.B. dass prozentual mehr Leute auf ein Auto oder Bahnabonnement angewiesen sind, Marktnähe) überhaupt gar nie gesprochen wird, machen auch unterschiedliche Rechnungsführungspraxisen die Vorlage undurchsichtig. So hat die Stadt beispielsweise ihre Liegenschaften nicht neu bewertet, wie dies alle anderen Gemeinden obligatorisch tun mussten: Täte Zürich dies, würde es keinen Bilanzfehlbetrag mehr ausweisen. Die neuen Aktiven stünden zwar nicht sofort zur Verfügung, könnten aber durch den Verkauf von Liegenschaften (von denen die Stadt sowieso viel zu viele hält) verflüssigt werden.
Undursichtig sind auch die Sparmassnahmen, derer sich die Stadt rühmt. Der Stimmbürger weiss zwar, dass im neunten, vielgelobten und von den Gewerkschaften bekämpften Sparpaket der Stadt eine Salärreduktion von 2.3 Prozent enthalten ist. Er soll aber nicht wissen, dass diese durch eine Verkürzung der Arbeitszeit um zwei Tage und durch die Schaffung von (laut Tages-Anzeiger) «mehreren hundert Stellen für Langzeit-Arbeitslose» wieder aufgefangen wurde und dass das Personal dank einer glücklichen Anlagepolitik der Pensionskasse deshalb trotz Kürzung von Lohn und Arbeitszeit netto mehr verdienen wird als bisher. Die übrigen Inhalte des Sparpakets sind keine Streichung bisheriger Ausgaben, sondern lediglich Verzicht auf geplante, beispielsweise der Verzicht auf einen Kinderhort im Finanzdepartement der Stadt.
Noch ein Kuriosum zur unterschiedlichen Budgetierungspraxis: Während die Stadt bereits mit 78,6 Millionen Franken Lastenausgleich rechnet (also so budgetiert als ergäbe sich am 7. Februar ein Ja) tut der Kanton das Gegenteil, er budgetiert als gäbe sich am 7. Februar ein Nein. Beide, Stadt und Kanton können somit knapp ein ausgeglichenes Budget präsentieren. Folge davon: Stimmen wir am 7. Februar «Ja», dann fehlt das Geld beim Kanton, stimmen wir «Nein», so fehlt es bei der Stadt, irgendwo fehlt’s auf jeden Fall. Der weise Investor gibt nun das Geld wohl demjenigen, welcher vertrauenswürdiger zu haushalten scheint. Dies ist für mich eindeutig der Kanton.