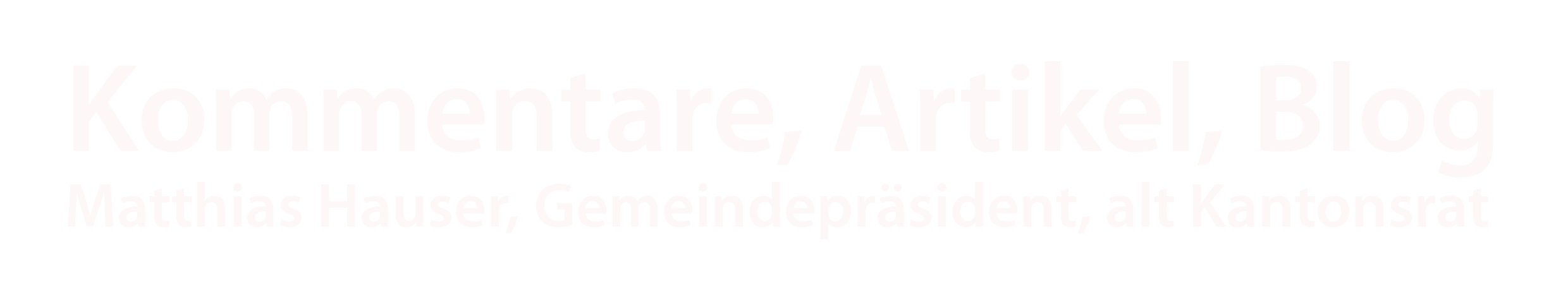Um die Gesundheitspolitik kommt in Zukunft der Laie, der die Demokratie mitgestalten und Lösungen mittragen soll, nicht herum. Die Herausforderungen sind gross.
Umso wichtiger ist ein guter Überblick. Gesundheitspolitik ist nicht mein Kerngebiet. Für alle jene, denen es genau so geht, ein kleiner Lesetipp:
Buchempfehlung: Durchblick im Gesundheitswesen
Gesundheit verschlingt jährlich 4.83 Milliarden Franken aus der Bundeskasse, 16.26 Milliarden von den Kantonen, zwei Milliarden von den Gemeinden und 28.7 Milliarden aus den Obligatorischen Krankenpflegeversicherungen (Prämien!). Dazu kommen 5.4 Milliarden aus Privatversicherungen und 23.5 Milliarden bezahlen die Einwohnerinnen und Einwohner direkt. Die Zahlen sind von 2016, zusammengezählt rund 78 Milliarden – 2018 waren wir bei 82 Milliarden, eine gewaltige, steigende Summe, fast CHF 12’000 pro Einwohnerin und Einwohner, obwohl viele gar nicht krank sind. Pandemien, die das System kurzzeitig stressen, wie Covid-19, nicht eingerechnet und – natürlich – auch Arbeitsausfälle nicht eingerechnet.
Nicht nur sind die Zahlen gross, auch die Akteure sind deren viele. Und auf allen politischen Ebenen verwoben. Es beginnt beim Einzelnen, der verschiede Ansprüche an das System hat, die Schwelle zur Krankheit individuell spürt und definiert. Dann Versicherungen, die eher auf die Kostenbremse drücken, Ärzte, die bestimmte Leistungen unabhängig von der Qualität und der Dringlichkeit des Bedarfs verrechnen können, die Marktsituation bei den Medikamenten, die öffentliche Hand auf allen Ebenen: Gemeinden (oft für Pflege und Heime verantwortlich), Regionen und Kantone (Spitäler) und Bund.
Herausforderung Kostensteigerung
Können wir uns die Qualität, die wir in der Schweiz verglichen mit manchen anderen Ländern haben, noch leisten? Wenn nicht: Gibt es dann Menschen, die an einer Krankheit sterben müssen, während dem andere, weil sie bezahlen können, weiterleben dürfen, Leben als Privileg? Welche gesundheitlichen Einschränkungen muss der Einzelne für sich selbst beseitigen und halt damit umgehen können, falls er/sie sich die Behandlung nicht leisten kann, Unversehrtheit als Privileg?
Insgesamt, das macht das Büchlein «Durchblick im Gesundheitswesen» deutlich, ist das System recht austariert.
Anpassen statt Aufheben – weiterhin System austarieren
Die Gesundheitspolitik hat Schräubchen, an denen gedreht werden könnte. Zum Beispiel einschränken, was in die Grundversicherung gehört. Zum Beispiel könnte man den Vertragszwang (dass Krankenversicherungen bei jedem Arzt die Leistung bezahlen müssen) anpassen. Aufheben geht meiner Meinung nach zu weit – Ärzte haben vom Staat ein Grundvertrauen Kraft ihres Abschlusses verdient und Patienten müssen wiederum den Arzt ihres persönlichen Vertrauens wählen können. Aber eine Einschränkung, so dass für häufige Behandlungen die Wirtschaftlichkeit optimiert werden kann, sollte angestrebt werden. Auch kann die finanzielle Betroffenheit der Patienten bei «leichter und häufiger Beanspruchungen des Gesunheitssystems» erhöht werden, so dass man vor dem Auslösen von Kosten zwei Mal überlegt. Und man investiert in die Prävention, die im Büchlein nicht vorkommt.
Die Autoren gehen mit den Ideen manchmal über das leichte Drehen am Schräubchen hinaus. So bei den Kantonsspitälern. Sie stellen die heutige Governance als Problem dar: Der Kanton ist gleichzeitig Besitzer der Kantonsspitäler (führt sie, ist an wirtschaftlicher Performance interessiert), und neutrale Behörde für alle Spitäler, z.B. um zu bestimmen, welches Spital auf die Spitalliste kommt und so öffentliche Mittel erhält. Klar, privatisiert man das Unispital, dann ist Gewaltentrennung bereinigt. Aber für bestimmte Leistungen, Forschung und Fortschritt in Behandlungsmethoden und für allerhöchste, superteure Spitzenmedizin, die sich in kleinen Spitälern nicht lohnt – dafür braucht es ein Kantonsspital, das Unispital, wo die öffentliche Hand gebündelt investiert, denn diese Zwecke sind überhaupt nur bedingt wettbewerbstauglich. Und es ist dann auch richtig, dass ein Spital des Kantons politisch kontrolliert werden kann, also sich die Behörden nicht hinter «es frisst zwar Steuern, ist aber selbständig» verstecken können. Anders sieht die Sache wieder beim Kantonsspital Winterthur aus: Hier sind wir auf einer Ebene mit dem Stadtspital Triemli oder dem Regionalspital Bülach und anderen.
Der Vorschlag nach Governance-Bereinigung in Ehren, die Richtung stimmt, absolut umgesetzt geht er zu weit – und finanziell ist damit das Gesunheitssystem nicht gerettet.
Keine Lösung in Sicht
Wir müssen das System verstehen und laufend austarieren. Das hört nie auf. Es gibt, aussert wir wären alle gesund, kein Rezept für tiefe Kosten und eine umfassende Versorgung, verschiedenste Interessen stehen sich gegenüber. Doch wenn wir auch in Zukunft gemässigt steuern wollen, so ist es höchste Zeit, die Schräubchen beherzt Richtung etwas mehr Eigenverantwortung zu stellen.